Buchtipp - Robert Harrison: Die Herrschaft des Todes
Bücher über den Tod sind eine Gratwanderung: Wir erleben ihn so lange aus zweiter Hand, wie wir über ihn berichten können. Tritt er dann ein, kann man nicht mehr vom Erleben reden - Berichtsmöglichkeiten bestehen ohnehin nicht mehr.
Alles ist Spekulation: Das Phänomen des Todes entzieht sich im Gegensatz zum Sterben der Beschreibung. Also alles vergebliche Mühe?
Mitnichten, wie das neue Buch von Robert Harrison zeigt.
Der in Stanford lehrende Literaturwissenschafter und Italianist mit ausgeprägten philosophischen Neigungen hat vor drei Jahren einen Essay unter dem Titel The Dominion of the Dead (Die Herrschaft der Toten) vorgelegt.
Der Titel der deutschen Übersetzung lautet jedoch: Die Herrschaft des Todes - weshalb der Titel geändert wurde, ist nicht ganz einsichtig. Das Thema einer Herrschaft des Todes oder besser einer Herrschaft der Toten ist nicht neu: Besonders der Ägyptologe und Kulturtheoretiker Jan Assmann hat mit seinen Arbeiten zum Alten Ägypten das Leben mit den Toten immer wieder zum Schwerpunkt seiner Forschungen gemacht (u.a. mit dem Titel Der Tod als Thema der Kulturtheorie. Frankfurt/M. 2000).
Robert Harrison möchte in seiner gelegentlich etwas ausufernden Studie verdeutlichen, welchen Reichtum des Lebens dessen Endlichkeit verdankt.
Danach kann sich eine Gesellschaft nur als human bezeichnen, wenn sie sich ihrer Wurzeln bewusst ist. Und am Ende bleibt es Sache der Kunst, dieses Bewusstsein wach zu halten.
Harrison macht uns Lesern deutlich: Die Toten sind unter uns. Sie bewohnen - so ein vom Autor gern gebrauchter Ausdruck - unsere Häuser und Institutionen, unsere Bilder, Wörter und Bücher, Träume, Herzen, Gebete und Gedanken. Als Hauptthese dieses Buches formuliert der Autor einleitend: Die Menschen begraben ihre Toten nicht einfach, um eine Trennung zu vollziehen, sondern auch und vor allem, um den Boden zu humanisieren, auf dem sie ihre Welten bauen und auf den sie ihre Geschichtsbilder gründen.
Oder anders ausgedrückt: Bevor die Menschen Häuser für sich bauten, schufen sie Behausungen für die Toten. Untermauert wird diese These von namhaften Gelehrten wie Lewis Mumford, der in seinem Werk über die Geschichte der Stadt (1961) diesen Gedanken verfolgt. Demnach ist die Totenstadt nicht nur älter als die Stadt der Lebenden, sondern deren Vorläuferin oder gar der Kern jeder lebendigen Stadt.
Wichtig ist Harrison, dass der Leichnam für die Hinterbliebenen zunächst der Ort einer ursprünglichen Erfahrung und auch ihrer eigenen Sterblichkeit ist: In seiner vollkommenen Übereinstimmung mit der Person, die dahingegangen ist, enthält der Leichnam eine Anwesenheit vor, während er zugleich eine Abwesenheit gegenwärtig macht. Dieser Gedanke scheint wie eine Wiederholung der Darstellungen von Thomas Macho, der zur Materialität des Toten ebenfalls die Paradoxie der Anwesenheit in Abwesenheit beschrieben hat (z.B. in Der Tod als Thema der Kulturtheorie. Frankfurt/M. 2000, S. 99ff.). Es ist eben befremdend, wenn man das Antlitz eines Leichnams betrachtet, der kurz zuvor noch ein lebendiger Mensch war.
Das Beunruhigende rühre von der Anwesenheit einer Leere an einer Stelle her, an der einst eine Person war. In dieser Leere, so vermutet Harrison, nähmen die drei Zeitdimensionen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ihren Anfang. In diesem Paradoxon hatte bereits Hans Belting den Ursprung und Impuls der bildenden Künste vermutet: Das Bild findet seinen wahren Sinn darin, etwas abzubilden, was abwesend ist und also allein im Bild da sein kann. Es bringt zur Erscheinung, was nicht im Bild ist, sondern im Bild nur erscheinen kann [...] Der Tote ist immer schon ein Abwesender, der Tod eine unerträgliche Abwesenheit, die man schnell mit einem Bild füllen wollte, um sie zu ertragen (Aus dem Schatten des Todes. Bild und Körper in den Anfängen, in: Constantin von Barloewen (Hg.), Der Tod in den Weltkulturen und Weltreligionen. München 1996, S. 94). Damit beginnt die Geschichte der Repräsentationen der materiellen Stellvertretungen sehr wahrscheinlich im Einklang mit der Geschichte der Totenkulte.
Im Buch ist viel von der Weisheit der Poesie die Rede - die Harrison viel und oft zitiert und zur Unterstreichung seiner Thesen anführt.
Eindringlichen Sätze wie dieser beeindrucken: Die Toten sind unsere Hüter. Wir geben ihnen eine Zukunft, damit sie uns eine Vergangenheit geben. Wir helfen ihnen dabei, zu leben, damit sie uns helfen, vorwärts zu schreiten. In diesem Zusammenhang mahnt Harrison uns Leser, dass auf uns die Verantwortung ruht, nicht allein das Andenken der Toten zu erhalten, sondern ihren humanen und larischen Wert. Die Laren sind die Haus- und Schutzgeister im alten Rom.
Harrsion macht uns klar, dass wir nur das Bindeglied zwischen Ungeborenen und Verstorbenen sind - zwischen zwei Zuständen angesiedelt (Geburt/Tod), von denen wir unterschiedliche Vorstellungen haben, über die wir aber nichts durch eigene Erfahrung wissen. Trotzdem redet kaum jemand von der Zeit, als er noch tot war.
Einer der wichtigen Begriffe seines Buches ist der Schallkasten, wie er ihn in einem Gedicht von Valerio Magrelli findet: Am Rande des Polarkreises/ weinte ein Paar in seinem Zimmer,/ hinter einer durchscheinenden Wand weinte es, einer leuchtenden,/ zarten, so als sei sie das Fell einer Pauke./ (Während ich vibrierte, als Schallkasten/ ihrer Geschichte.) Die Schallkästen findet Harrison in Gedichten, in Prosa und Drama der Weltliteratur, mit Schwerpunkt der italienischen Literatur und Philosophie.
Der Essay darf und soll allerdings nicht verstanden werden als ein Plädoyer gegen den Tod, wie es etwa Elias Canetti immer wieder gehalten hat. Die Endlichkeit des Lebens ist für Harrison gerade kein Ärgernis - wie selbstverständlich spricht er vom Todestrieb als einer anthropologischen Tatsache, geradezu als sei Freuds Theorie experimentell bestätigt.
Denn hierin liegt die eigentliche Stärke von Harrisons Buch:
Es ist nicht ausschließlich eine Beschäftigung mit dem Tod, so lesenswert viele seiner Gedanken dazu auch sind, sondern die Darbietung eines literarisch-philosophischen Schreibens, das es so in Deutschland kaum mehr gibt.
Harrison kann sich auf die Dichtung als intellektuelle Bezugsgröße verlassen, weil die angelsächsische Literatur keine Brüche in dieser Tradition aufweist.
Ein anregendes und vielseitiges Buch zu einem naturgemäß schwierigen Thema, geschrieben mit einer der deutschen Tradition fremden Leichtigkeit. Dennoch sind zum besseren Verständnis Vorkenntnisse in der europäischen Geistesgeschichte hilfreich. Für alle am Thema Interessierten ist dieses Buch aber wärmstens zu empfehlen.
Die Herrschaft des Todes
Robert Harrison
München, Hanser Verlag, 2006, 302 Seiten, EUR 24,90
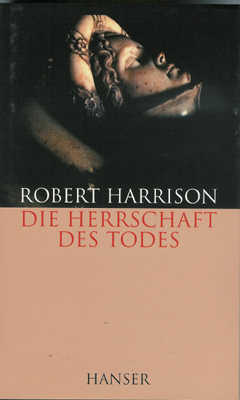

 7. Jun. 2006
7. Jun. 2006















